Allgemeine und berufliche Bildung
Schulabbruch und Ausbildungsabbruch verhindern
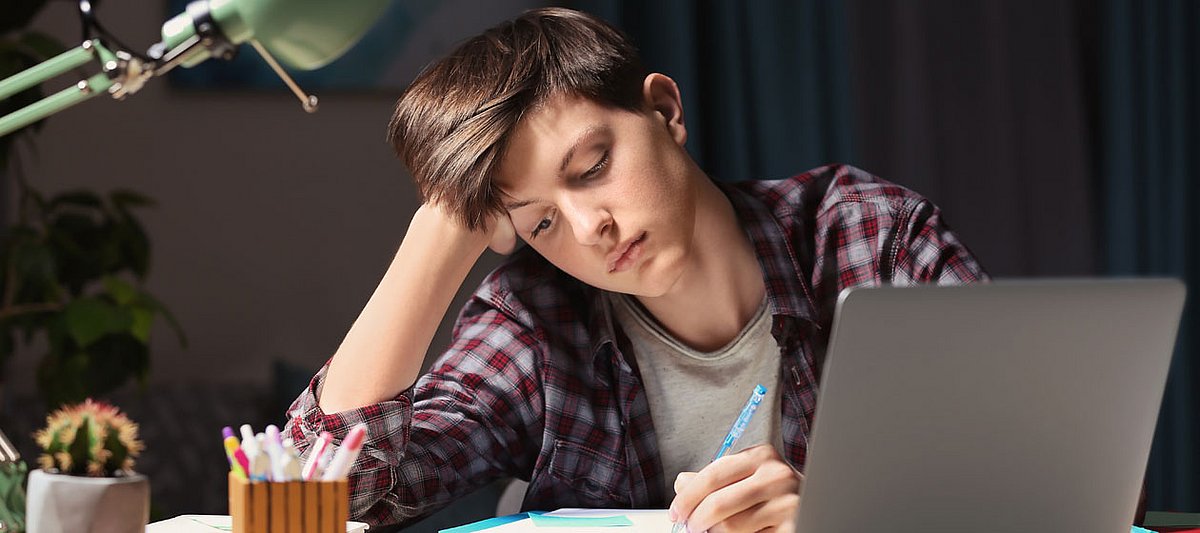
Weitere Themen zu allgemeine und berufliche Bildung
Vergleiche Inhalte in anderen Ländern
Nationale Strategie
Den Ergebnissen des Bildungsberichts 2022 sowie des Berufsbildungsberichts 2023 zufolge ist die Zahl der Schulabgänger:innen ohne Abschluss zwar zuletzt gesunken, bewegt sich aber dennoch mit einem Anteil von knapp 6 Prozent auf einem relativ hohen Niveau. Zudem ist der Anteil der vorzeitigen Vertragslösungen im Bereich der Berufsausbildung während der Corona-Pandemie angestiegen; zuletzt wurden fast 27 Prozent aller Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst. Eine große Herausforderung stellt zudem die hohe Zahl an Jugendlichen und jungen Erwachsenen dar, die bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unversorgt bleiben und die auch in späteren Jahren oftmals keinen beruflichen Abschluss nachholen (vgl. hierzu auch den Abschnitt „Aktuelle Befunde zur Bildungsbeteiligung junger Menschen“).
Richtet man den Blick auf die politischen Rahmenbedingungen, so ist in Deutschland keine flächendeckende Strategie zu finden, um Schul- und Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Dennoch gibt es von verschiedenen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen Maßnahmen, die jungen Menschen dabei helfen sollen, die Schule beziehungsweise die Berufsausbildung erfolgreich abzuschließen.
Der grundsätzliche Rahmen insbesondere im Hinblick auf die Reduktion von Schulabbrüchen wird zunächst von der Kultusministerkonferenz (KMK) abgesteckt. Bereits im Jahr 2007 verabschiedete die KMK einen Handlungsrahmen zur Reduzierung der Zahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss, Sicherung der Anschlüsse und Verringerung der Zahl der Ausbildungsabbrecher, der strategische Ziele und Handlungsfelder definiert, um gegen Schulabbruch vorzugehen.
Im Jahr 2010 vereinbarte die KMK sodann die Förderstrategie für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler, die auch heute noch Gültigkeit besitzt. Grundlegende Zielsetzung dieser Strategie ist es, den Anteil der Schüler:innen, die am Ende ihres Bildungsganges ein Mindestniveau der Kompetenzentwicklung nicht erreichen, zu reduzieren und die Zahl der Schüler:innen ohne Schulabschluss zu halbieren. Die Strategie sieht auch vor, dass die Bundesländer regelmäßig über das Erreichen dieser Ziele berichten. Der aktuellste Bericht über die Umsetzung der Förderstrategie stammt aus dem Jahr 2020.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) nimmt mit dem im Juli 2023 verkündeten Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung (Aus- und Weiterbildungsgesetz) die hohe Zahl an Jugendlichen in den Blick, denen der Übergang von der Schule in die Ausbildung nicht oder nicht unmittelbar gelingt und die oftmals auch in späteren Lebensphasen keinen formalen Berufsabschluss mehr erwerben. Durch die Einführung neuer Maßnahmen wie die Ausbildungsgarantie oder das Berufsorientierungspraktikum soll diesen jungen Menschen der Zugang zu einer Berufsausbildung eröffnet werden.
Eine Verringerung der Zahl der jungen Erwachsenen ohne Berufsabschluss wird auch von der Allianz für Aus- und Weiterbildung als relevantes Ziel erachtet, der Vertreter der Bundesregierung, der Bundesagentur für Arbeit (BA), der Länder sowie Spitzenorganisationen der Wirtschaft und Gewerkschaften angehören. In ihrer Gemeinsamen Erklärung für die Periode 2023 – 2026 benennt die Allianz verschiedene Maßnahmen, die der Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen dienen sollen. Hierbei handelt es sich unter anderem um Unterstützungsangebote während der Ausbildung sowie um die Intensivierung der Berufsorientierung.
Die Stärkung der Berufsorientierung, insbesondere an Gymnasien, ist schließlich auch eine Maßnahme, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in der im Dezember 2022 gestarteten Exzellenzinitiative Berufliche Bildung thematisiert. Ziel ist hier, durch eine bessere individuelle Chancenförderung sicherzustellen, dass junge Menschen ihr Potenzial in der Berufsbildung und nach dem Berufseinstieg bestmöglich entfalten können.
Formale Bildung: Wichtige politische Maßnahmen gegen Schulabbruch und Ausbildungsabbruch
Verschiedene Maßnahmen zielen in Deutschland auf eine Verringerung der Zahl der Schul- und Ausbildungsabbrecher:innen sowie der Zahl junger Menschen, die ohne Berufsabschluss bleiben, ab. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Berufsorientierung, Maßnahmen im Übergangsbereich sowie unterstützende Maßnahmen während der schulischen und beruflichen Ausbildung. Diese Maßnahmen werden teils in Initiativen des Bundes gebündelt und zwischen den Ressorts abgestimmt.
Maßnahmen zur Verhinderung von Schulabbruch
Da allgemeinbildende Schulen in Deutschland im Verantwortungsbereich der Bundesländer liegen, sind diese auch für Aktivitäten zur Verhinderung von Schulabbrüchen zuständig. Die Kultusministerkonferenz (KMK) berichtet regelmäßig über Maßnahmen, die die Länder zur Umsetzung der Förderstrategie für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler ergriffen haben. Im zuletzt veröffentlichten Bericht über die Umsetzung der Förderstrategie aus dem Jahr 2020 werden dabei Aktivitäten der Länder in den folgenden Handlungsfeldern beschrieben, wobei sich die konkret eingesetzten Maßnahmen zwischen den Ländern teils unterscheiden:
- Im Unterricht individuell fördern und Bildungsstandards sichern,
- mehr Lernzeit ermöglichen und gezielt unterstützen,
- Unterricht praxisnah gestalten,
- Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund stärker fördern, Chancen der Vielfalt nutzen,
- Hauptschulabschlüsse für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ermöglichen,
- geeignete Ganztagsangebote entwickeln und Bildungspartnerschaften stärken,
- Berufsorientierung professionalisieren sowie Übergänge gestalten und sichern,
- Lehrerbildung qualitativ weiterentwickeln,
- Ergebnisse evaluieren und Erfolgsmodelle verbreiten.
Berufsorientierung
Die Berufsorientierung dient dazu, dass Jugendliche möglichst frühzeitig ihre Stärken erkennen und Einblicke in die Berufswelt erhalten können. Dies kann auch zu einer besseren Passung von angestrebtem und realisiertem Ausbildungsberuf beitragen und somit helfen, Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Die Bundesregierung unterstützt Jugendliche bei der Berufsorientierung durch verschiedene Aktivitäten.
Ein zentraler Akteur im Bereich der Berufsorientierung und -beratung ist die Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Arbeitsagenturen bieten nicht nur Beratungsangebote während der Schulzeit, sondern auch nach deren Ende an. Die Broschüre „Die lebensbegleitende Berufsberatung der BA“ gibt einen Überblick über die verschiedenen Aktivitäten der Arbeitsagenturen. Neben Gruppenangeboten für Schulklassen und individuellen Einzelberatungen können Jugendliche sich auch in den Berufsinformationszentren informieren. Mit CheckU steht den Jugendlichen zudem ein digitales Selbsterkundungstool für Ausbildung und Studium zur Verfügung.
Neben den Angeboten der BA spielt auch das Berufsorientierungsprogramm (BOP) des Bundes eine wichtige Rolle. Dieses richtet sich an Schüler:innen ab der 7. Klasse, die durch Praktika oder Werkstatttage verschiedene Berufsfelder kennenlernen und sich so beruflich erproben können. Das BOP hat speziell auch die Stärkung der Berufsorientierung an Gymnasien (im Kontext der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung) sowie die gezielte Ansprache von Geflüchteten im Blick. Ergänzt wird das Programm durch digitale Berufsorientierungsmaßnahmen wie zum Beispiel das Online-Portal berufenavi.de oder die digitale berufswahlapp. Darüber hinaus bieten auch Landesprogramme Schüler:innen systematische Berufsorientierung an.
Die große Bedeutung der Berufsorientierung wird auch durch das 2023 verabschiedete Aus- und Weiterbildungsgesetz betont. So sieht dieses die Einführung eines Berufsorientierungspraktikums vor, das junge Menschen beim Übergang in eine Berufsausbildung unterstützen und durch eine bessere Passung von Ausbildungsbetrieb und Auszubildenden etwaigen Ausbildungsabbrüchen vorbeugen soll. Die Kosten für das Praktikum werden von den Arbeitsagenturen übernommen.
Zu weiteren Informationen zum Thema Berufsorientierung und -beratung siehe auch das Youth-Wiki-Kapitel „Beschäftigung und Unternehmertum: Berufsorientierung und -beratung“.
Maßnahmen beim Übergang von Schule in Ausbildung und Beschäftigung
Der sogenannte Übergangsbereich bereitet junge Menschen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, auf eine betriebliche Ausbildung vor. Wichtige Maßnahmen im Übergangsbereich sind die Einstiegsqualifizierung sowie Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, die von der Bundesagentur für Arbeit angeboten werden. Die Einstiegsqualifizierung (EQ) ist ein sozialversicherungspflichtiges Praktikum, das junge Menschen bei ihrer beruflichen Orientierung unterstützen kann. EQ kann auch zu einer besseren Passung von Betrieb und Auszubildenden beitragen und somit die Gefahr von Ausbildungsabbrüchen reduzieren. Durch eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) erhalten junge Menschen Einblick in unterschiedliche Berufsbilder und können über dieses Angebot auch einen Hauptschulabschluss nachholen. BvB dauern in der Regel neun bis zehn Monate.
Das Aus- und Weiterbildungsgesetz sieht zudem für das Jahr 2024 die Einführung einer Ausbildungsgarantie vor, die allen jungen Menschen, die keinen Berufsabschluss haben, den Zugang zu einer vollqualifizierenden, möglichst betrieblichen Berufsausbildung eröffnen soll. Hierfür werden vorhandene Unterstützungsangebote der Arbeitsagenturen wie beispielsweise die Einstiegsqualifizierung ausgeweitet und mit neuen Ansätzen wie dem Berufsorientierungspraktikum kombiniert. Junge Menschen, die trotz umfassender Bemühungen keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden, sollen dem neuen Gesetz zufolge einen Anspruch auf eine außerbetriebliche Ausbildung haben.
Eine wichtige Rolle beim Übergang von Schule in Ausbildung und Beschäftigung spielen auch die Jugendberufsagenturen, die darauf abzielen, die Integrationschancen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Arbeitswelt und Gesellschaft zu verbessern. Hierzu sollen die Kompetenzen der zuständigen Institutionen enger verzahnt werden, sodass junge Menschen „wie aus einer Hand“ unterstützt werden können. Jugendberufsagenturen sind Arbeitsbündnisse, in denen unter anderem Arbeitsagenturen, Kommunen, Schulen, Jugendmigrationsdienste, Arbeitgeberorganisationen sowie die Jugendgerichtshilfe kooperieren. Die vom BMAS initiierte Servicestelle Jugendberufsagenturen, die beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) angesiedelt ist, unterstützt und berät die örtlichen Jugendberufsagenturen bundesweit.
Unterstützende Maßnahmen während der Ausbildung
Um junge Menschen bei der Aufnahme einer Ausbildung sowie der Hinführung auf einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss zu unterstützen, wurde 2021 das Programm Assistierte Ausbildung flexibel (AsAflex) eingeführt. AsAflex verbindet die zuvor eingesetzten Instrumente „Assistierte Ausbildung“ (AsA) und „Ausbildungsbegleitende Hilfen“ (abH); für die Durchführung sind die Arbeitsagenturen verantwortlich. Die Unterstützungsleistung orientiert sich am individuellen Bedarf der Jugendlichen; es wird eine Ausbildungsbegleitung eingesetzt, die sowohl Bezugsperson für die Auszubildenden als auch Ansprechpartner:in für den Ausbildungsbetrieb ist.
Mit der durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützten Initiative VerA - Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen steht darüber hinaus eine ehrenamtliche Ausbildungsbegleitung mit individuellen Coaching-Angeboten zur Verfügung. Fachleute im Ruhestand fungieren dabei als Ausbildungsbegleiter:innen und unterstützen junge Menschen darin, ihre Ausbildung erfolgreich abzuschließen.
Die zuvor genannten Maßnahmen sind teils auch Gegenstand der Initiative Bildungsketten, die im Jahr 2010 als Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), der Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Länder ins Leben gerufen wurde. Derzeit befindet sich die Initiative in der Phase II, die eine Laufzeit von 2021 bis 2026 hat. Von den beteiligten Akteuren wird dabei eine ganzheitliche Förderphilosophie verfolgt, die unter dem Motto „Prävention statt Reparatur“ steht.
Schulabbruch und Ausbildungsabbruch durch non-formales und informelles Lernen sowie hochwertige Jugendarbeit angehen
Verschiedene Initiativen des Bundes zielen darauf ab, die Jugendarbeit vor Ort zu stärken und dadurch auch Schul- und Ausbildungsabbrüchen vorzubeugen.
Die Initiative JUGEND STÄRKEN des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bündelt seit 2009 die Programme der Jugendsozialarbeit unter einem Dach. Ziel ist es, junge Menschen mit individuellen Ansätzen am Übergang von der Schule in den Beruf zu begleiten und die Kooperation verschiedener Einrichtungen vor Ort zu verbessern. Dabei steht die Erprobung einer bedarfsgerechten, systematischen Steuerung und Koordinierung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit in Zusammenarbeit mit der Schule und den lokalen Arbeitsmarktakteuren im Fokus. Angebote sollen möglichst individuell, niederschwellig und vor Ort erfolgen.
Zur Initiative Jugend stärken gehören die folgenden Programme:
- JUGEND STÄRKEN im Quartier (Förderung benachteiligter junger Menschen am Übergang von Schule-Beruf in benachteiligten Regionen)
- JUGEND STÄRKEN: 1000 Chancen (Unterstützung benachteiligter junger Menschen durch praxisnahe, niedrigschwellige Unterstützungsangebote und Einblicke in die Arbeitswelt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft)
- JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit (Unterstützung junger Menschen an der Schwelle zur Selbstständigkeit)
- Jugendmigrationsdienste (Beratung, Begleitung und Bildung junger Menschen mit Migrationshintergrund)
- Respekt Coaches (präventive Angebote, die Respekt, Toleranz und den Abbau von Vorurteilen an Schulen fördern sollen)
Das ebenfalls durch das BMFSFJ unterstützte Programm "ElternChanceN - mit Elternbegleitung Familien stärken" zielt darauf ab, die Strukturen der Elternbegleitung vor Ort zu stärken. Dabei soll durch die Einbindung der Elternbegleitung in ein kommunales Netzwerk von Familienbildung und -beratung die bedarfsgesteuerte Umsetzung von Maßnahmen ermöglicht werden. Involviert sind neben den Jugendämtern auch weitere kommunale Einrichtungen der Familienbildung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bildungswegbegleitung. So sollen niedrigschwellige Bildungsangebote umgesetzt werden, die den Eltern Hilfestellung bei der Erziehung und Bildungswegbegleitung ihrer Kinder bieten.
Bei der Initiative Schulewirtschaft schließlich handelt es sich um ein Netzwerk von Schulen und Unternehmen, die sich gegenseitig unterstützen und zusammenarbeiten. Eine wesentliche Bedeutung kommt dabei auch der Berufsorientierung zu. Die Zusammenarbeit findet vor Ort statt; neben Vertreter:innen aus Schulen und Betrieben sind auch Arbeitgeberverbände, Kammern und Kommunen beteiligt. Das ehrenamtliche Engagement einzelner Beteiligter wird durch hauptamtliche Geschäftsstellen entlastet.
Ressortübergreifende Koordination und Monitoring von Hilfen gegen Schulabbruch und Ausbildungsabbruch
Behördenübergreifende Partnerschaften
Eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Ressorts beziehungsweise Behörden gibt es innerhalb verschiedener Initiativen. So gehören der Allianz für Aus- und Weiterbildung, die im Jahr 2014 beschlossen wurde, Vertreter:innen der Bundesregierung, der Bundesagentur für Arbeit, der Länder sowie Spitzenorganisationen der Wirtschaft und Gewerkschaften an. Das Bündnis setzt sich dafür ein, die Attraktivität, Qualität, Leistungsfähigkeit und Integrationskraft der beruflichen Bildung zu fördern. In ihrer Gemeinsamen Erklärung für die Periode 2023 – 2026 wird dabei auch die Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen als ein wichtiges Anliegen genannt. Die Erklärung sieht unter anderem vor, dass Schulen im Kontext der Berufsorientierung eng mit den Arbeitsagenturen zusammenarbeiten und dass Kooperationen zwischen Schule und Jugendarbeit, Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit gestärkt werden sollen.
Auch bei der oben erwähnten Initiative Bildungsketten kommt es zu einer ressort- beziehungsweise behördenübergreifenden Zusammenarbeit. So stimmen das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit den Ländern, Kommunen und Schulen ihre Aktivitäten und Programme aufeinander ab. Sie übernehmen gemeinsam die Verantwortung für die Begleitung und Unterstützung von jungen Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf und verfolgen dabei eine ganzheitliche Förderphilosophie.
Zudem zielen auch die beschriebenen Initiativen ElternChanceN, JUGEND STÄRKEN und SchuleWirtschaft sowie die Jugendberufsagenturen auf eine behördernübergreifende Zusammenarbeit relevanter Einrichtungen vor Ort ab.
Zu mehr Informationen vgl. auch den Bericht von Eurydice und Cedefop zum vorzeitigen Ausscheiden aus der allgemeinen und beruflichen Bildung (auf Englisch).
Monitoring und Evaluation
Informationen zu Schul- und Ausbildungsabbrüchen stellen der Bildungsbericht sowie der Berufsbildungsbericht mit dem dazugehörigen Datenreport zur Verfügung.
Mit dem Berufsbildungsbericht kommt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seinem gesetzlichen Auftrag nach, die Entwicklung in der beruflichen Bildung kontinuierlich zu beobachten und der Bundesregierung jährlich zum 1. April Bericht zu erstatten. Dabei werden auch Befunde zu Ausbildungsabbrüchen und unversorgten Ausbildungsplatzbewerber:innen dargestellt und die neuen und laufenden berufsbildungspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung erläutert. Hierunter fallen auch Programme wie die „Initiative Bildungsketten“ und „Jugend Stärken“, die die Prävention von Schul- oder Ausbildungsabbruch zum Ziel haben und die Berufsorientierung in unterschiedlichen Formen unterstützen. Der Berufsbildungsbericht wird um weitere Befunde und tiefergehende Analysen ergänzt durch den dazugehörigen Datenreport, der jährlich vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) herausgegeben wird.
Der Bildungsbericht ist Teil der für den Schulbereich 2006 von der Kultusministerkonferenz (KMK) erklärten und 2015 überarbeiteten Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring in Deutschland. Er erscheint alle zwei Jahre, zuletzt im Jahr 2022. Der Bildungsbericht geht auf verschiedene Bereiche der Bildung ein und thematisiert dabei unter anderem auch Schul- und Ausbildungsabbrüche.
Einen Überblick über die Entwicklung der Schulabgänger:innen ohne Abschluss, differenziert nach Bundesländern, gibt zudem der Bericht über die Umsetzung der Förderstrategie der Kultusministerkonferenz (KMK).
Verbindung zur Jugendgarantie
Im Rahmen der Umsetzung der Jugendgarantie wurden Maßnahmen wie die assistierte Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen eingeführt und andere, wie die Zusammenarbeit zwischen den Jugendberufsagenturen, gestärkt. Die von der EU-Jugendgarantie vorgeschlagenen Empfehlungen wurden weitgehend aufgegriffen und in Deutschland umgesetzt. Rechtlich vorgeschriebene Vermittlungsangebote wurden mehrfach angepasst.
Die Agenturen für Arbeit sind nach Art. 37 Sozialgesetzbuch Drittes Buch verpflichtet, mit Arbeits- oder Ausbildungssuchenden eine Eingliederungsvereinbarung abzuschließen. Diese muss bei jungen Menschen nach spätestens drei Monaten überprüft werden. Die Eingliederungsvereinbarung umfasst das Eingliederungsziel, die Vermittlungsbemühungen der Agenturen für Arbeit, die Eigenbemühungen der Jugendlichen, die eine Ausbildung bzw. Arbeit suchen und die vorgesehenen Leistungen der Arbeitsförderung. Auf dieser Grundlage haben auch Jugendliche im arbeitsfähigen Alter, die Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten, Vorrang bei der Vermittlung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen.
©
Dieser Artikel wurde auf www.youthwiki.eu in englischer Sprache erstveröffentlicht. Wir danken für die freundliche Genehmigung der Übernahme.

